KIRCHE UND REVOLUTION
Kirche in der DDR-Gesellschaft
Hintergrund
Zur Staatsdoktrin der DDR gehört das Bekenntnis zum Atheismus. Kirchenzugehörigkeit gilt als Ausdruck rückständigen Bewusstseins. Von Mitgliedern der Staatspartei SED wird erwartet, dass sie keiner Kirche angehören. Zwar ist Religionsfreiheit von der Verfassung garantiert. Wer sich aber im kirchlichen Bereich engagiert, muss mit Benachteiligung etwa im Bildungswesen oder in der beruflichen Karriere rechnen.
Die Politik der Regierung gegenüber Kirchen und Religionsgemeinschaften pendelt zwischen Repression und Vereinnahmungsversuchen. Es kommt zu einem erheblichen Mitgliederschwund in den Gemeinden. Dennoch vermögen die Kirchen ihre Eigenständigkeit gegenüber dem Verfügungsanspruch des Staates weitgehend zu bewahren.
Neben missionarischen Initiativen, die eher unpolitisch agieren, entdecken Christinnen und Christen unterschiedlicher Konfession die emanzipatorische Kraft der biblischen Botschaft. Das ermächtigt sie, sich dem Anpassungsdruck von Seiten des SED-Regimes zu widersetzen. Kirche ist trotz aller Einschränkungen in erstaunlicher Breite in der Gesellschaft präsent.
Die Strahlkraft der Studentengemeinden mit ihrem intellektuellen Potential reicht weit in den säkularen Bereich hinein. Junge Gemeinden sind für Jugendliche Inseln der Freiheit bei der Suche nach einem selbstbestimmten Leben. Die „Offene Arbeit“ bietet Teilen der Subkultur Raum und Begleitung. Kirche dient als Schutzraum für unangepasste Künstlerinnen und Künstler und ermöglicht eine begrenzte Öffentlichkeit. Die Kirchenmusik ist in ihrer Breite wie mit ihrem hohen Niveau ein prägender Teil der Musikkultur.
In Diakonie und Caritas leisten Frauen und Männer aufopferungsvollen Dienst an den Schwächsten der Gesellschaft. Die evangelischen Kirchen sind von der Gemeinde- bis zur Landesebene demokratisch strukturiert. So wirken sie als Schulen der Demokratie inmitten einer Diktatur. Im letzten Jahrzehnt der DDR agieren Vertreter der Basisgruppen zunehmend selbstbewusster und gehen mit Forderungen nach Gewährung demokratischer Grundfreiheiten an die Öffentlichkeit.
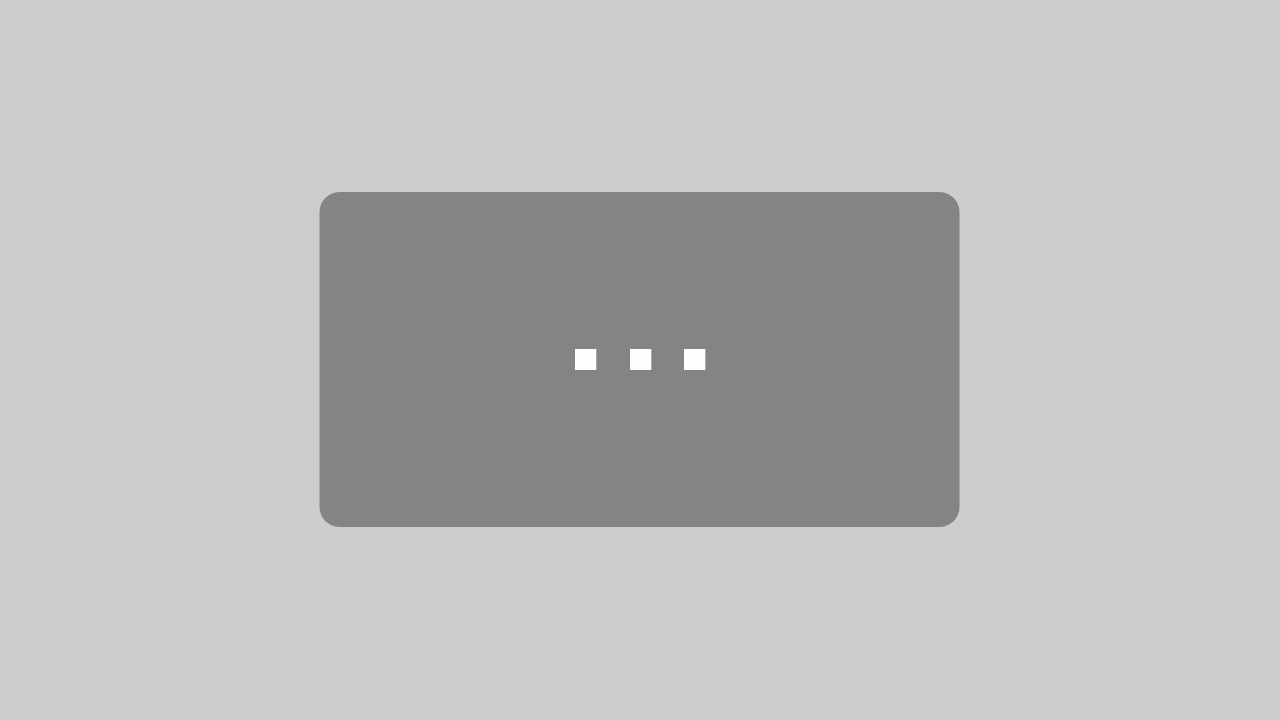
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Hans-Jürgen Röder, in den 1980er Jahren Ostberlin-Korrespondent des epd, über die Rolle der Kirche in den 1980er Jahren
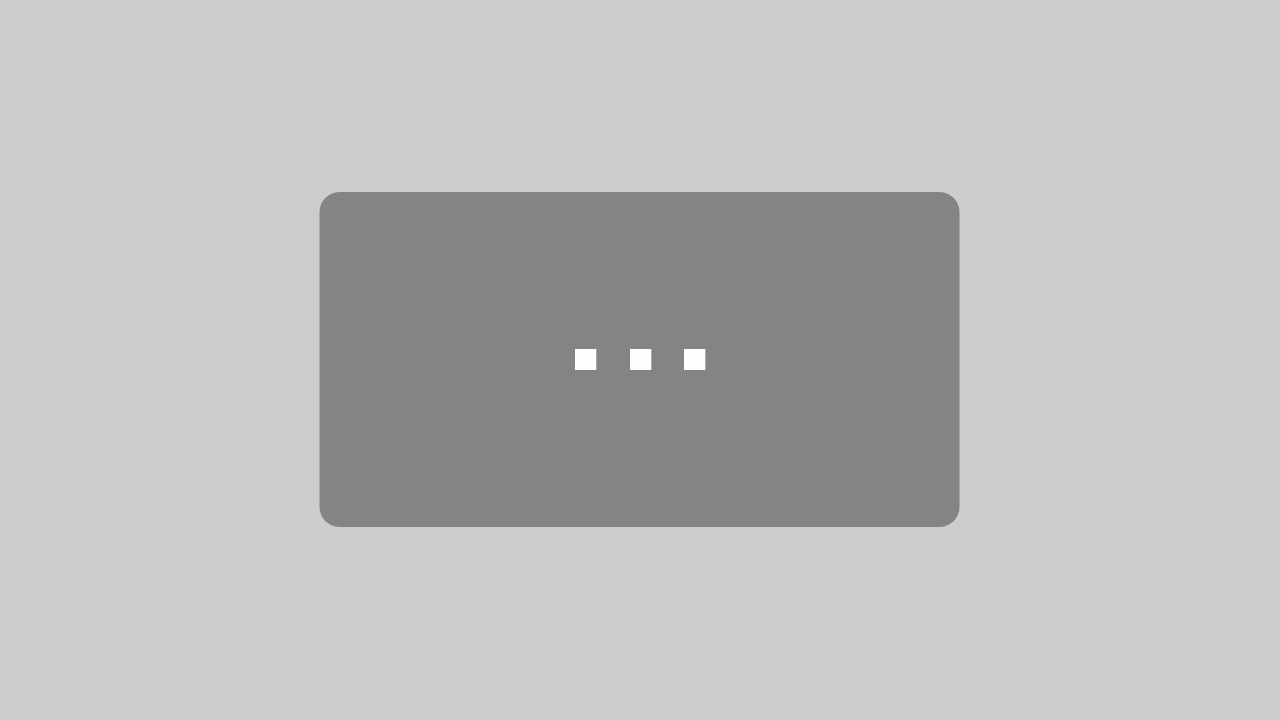
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Pfarrer Bernd Albani über Kirche in der DDR als Lernort der Demokratie
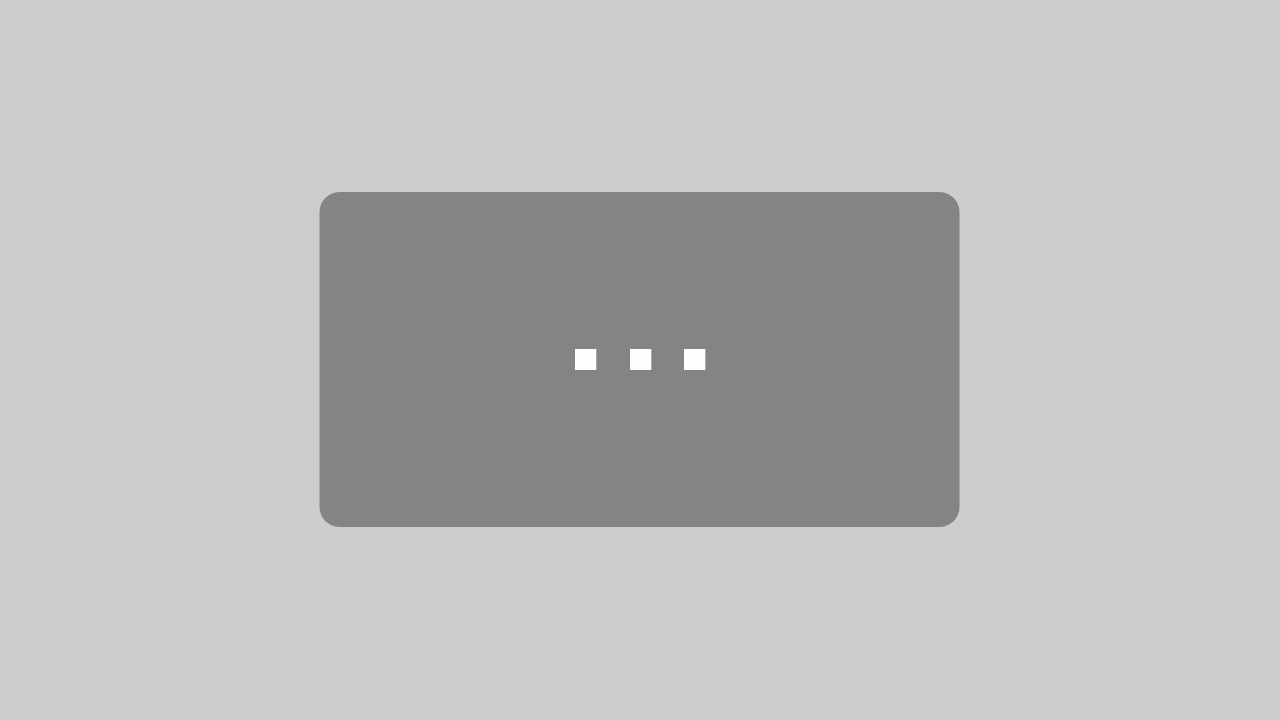
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Hans-Jürgen Röder, in den 1980er Jahren Ostberlin-Korrespondent des epd, über Kirche als Schule der Demokratie
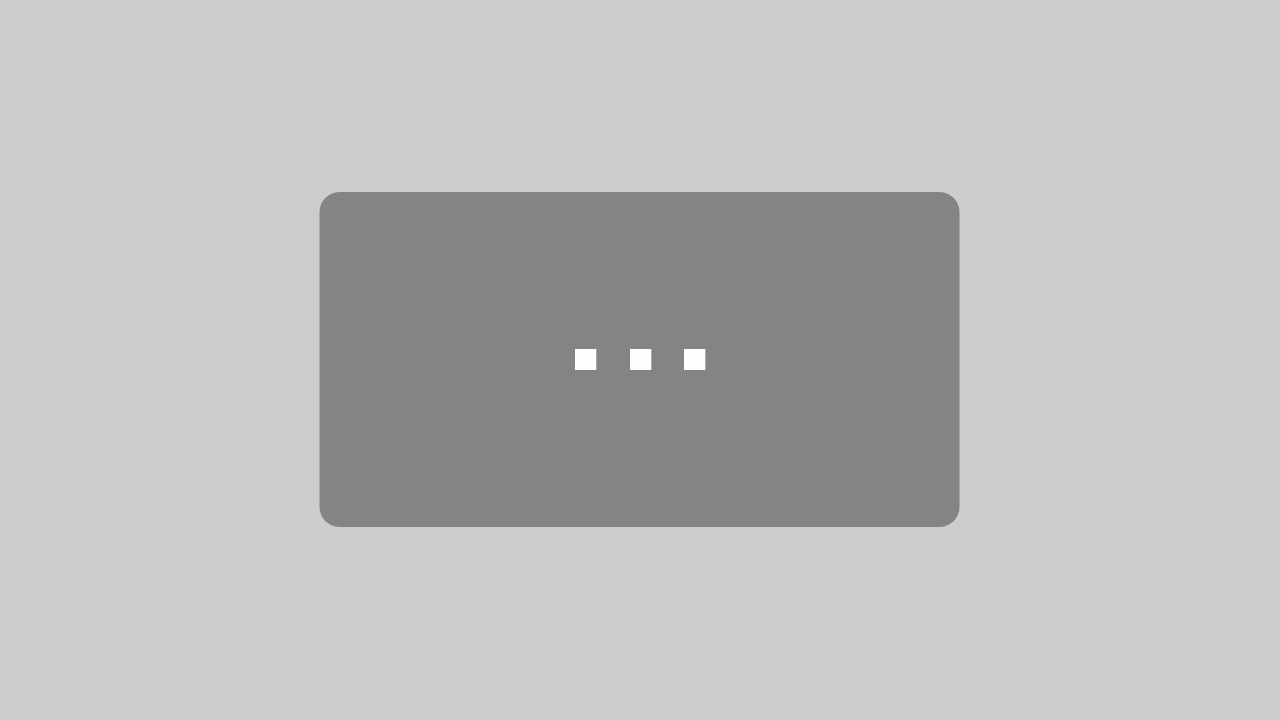
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Bernd Albani über Kirche in der DDR als Schutzraum
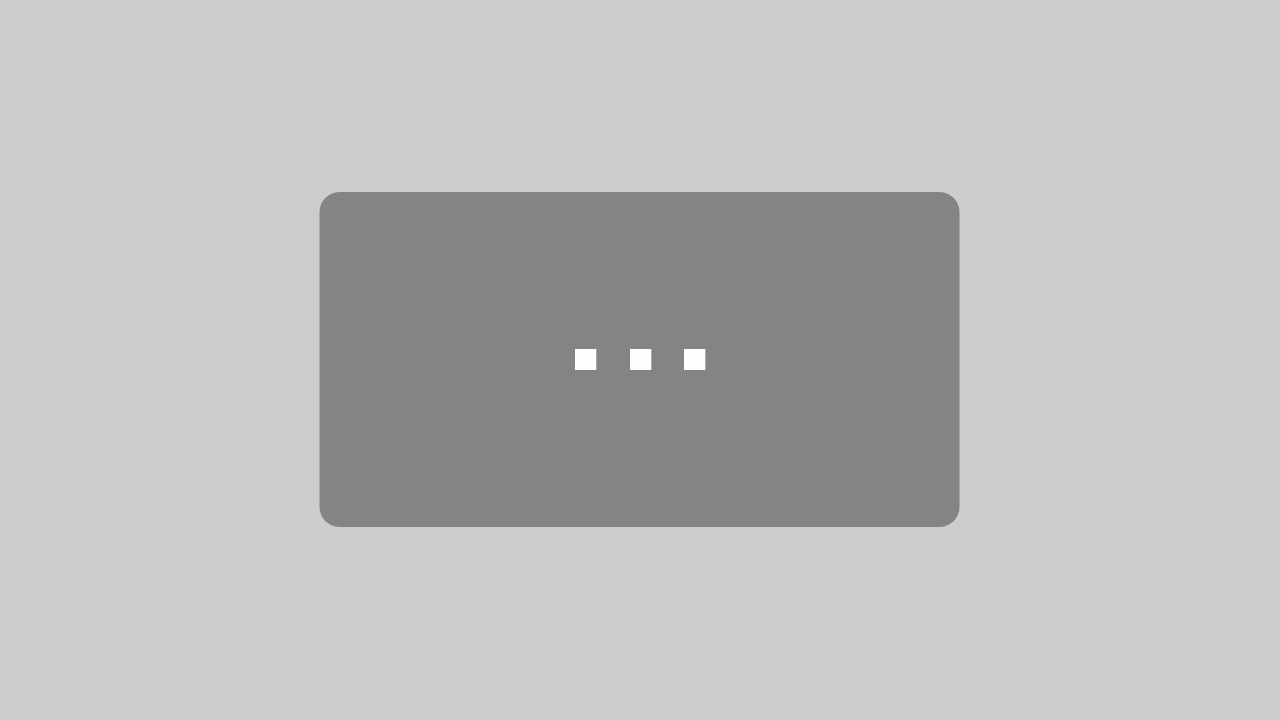
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Bernd Albani über Kirche in der DDR-Gesellschaft
Studentengemeinden
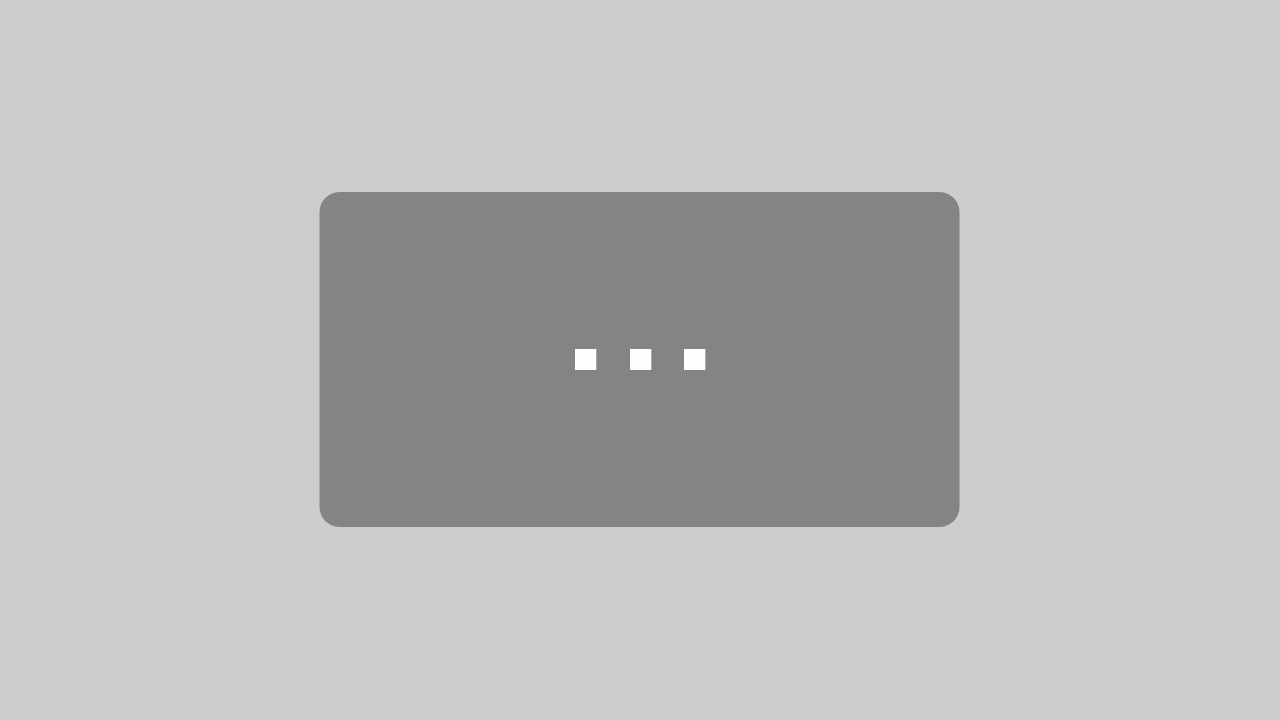
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Was für Jürgen Israel, 1965 bis 1970 Germanistikstudent, die Studentengemeinden attraktiv machte
Vertrauensstudentinnen und -studenten der ESG Dresden im Sommersemester 1967 vor dem „Bau“. Im Souterrain der Ruine eines Gemeindehauses wurden Räume für die Studentengemeinde eingerichtet. Gemeinsam mit dem Studentenpfarrer leiten die Vertrauensstudenten die Gemeinde.
Quelle: Bernd Albani
Ludwig Baum, katholischer Studentenpfarrer in Dresden in den 1960er Jahren. Zwischen der KSG und der ESG in Dresden gibt es regen Austausch. Ludwig Baum war bereits in den 1930er Jahren Studentenseelsorger in Dresden. Er wurde 1938 wegen seiner kritischen Haltung zum Nationalsozialismus abberufen.
Quelle: Archiv Thomas Brose
Offene Arbeit
Ab Ende der 1960er Jahre ergeben sich zunehmend Berührungspunkte zwischen kirchlicher Jugendarbeit und den subkulturellen Milieus der Hippies und Langhaarigen sowie von Aussteigerinnen und Aussteigern. Vorreiter dieser „Offenen Arbeit“ sind Pfarrer Walter Schilling im thüringischen Braunsdorf und Pfarrer Claus-Jürgen Wizisla in Leipzig.
Die gegen Bevormundung und Konformitätsdruck aufbegehrenden Jugendlichen sind für sie keine „Betreuungsobjekte“. Vielmehr sehen sie in deren Protest- und Verweigerungshaltung ein emanzipatorisches Potential. In Wizislas „Thesen zur Begründung und Zielsetzung offener Jugendarbeit“ aus dem Jahr 1972 heißt es: Die „Entfaltung der Jugendlichen“ solle durch „freie Meinungsäußerung und eigene Urteilsbildung“ sowie „durch Einüben von Kritikfähigkeit und verantwortlichem Engagement“ ermöglicht werden.
Dieses Konzept ist ein Gegenentwurf zur gängigen DDR-Pädagogik, die Disziplinierung und Anpassung zum Ziel hat.
Von Jesus reden, heißt von Politik reden
Walter Schilling richtet in Nebengebäuden seiner Pfarrei im thüringischen Braunsdorf ein „Jugendheim“ ein, das in den 1970er Jahren zu einem Anlaufpunkt für Jugendliche aus der Region wird. Hier treffen sich Wehrdienstverweigerer, Vorbestrafte, Alkoholkranke, sozial Ausgegrenzte sowie Aussteigerinnen und Aussteiger aller Art. Walter Schilling – „Von Jesus reden, heißt von Politik reden“ – bietet den jungen Leuten Seelsorge, Begleitung und Beratung. Auch junge Menschen aus dem Arbeitermilieu, Studierende und Mitarbeitende aus eher konventionellen Gemeinden fühlen sich angezogen.
Vom 30. Juni bis 2. Juli 1978 findet in Rudolstadt unter Leitung von Walter Schilling und dem Stadtjugendpfarrer Uwe Koch ein Werkstattwochenende „June 78“ zum Thema Apartheid statt. Im Zentrum steht nicht nur der Umgang mit Behinderten, sondern auch mit Ausländerinnen und Ausländern in der DDR. Es gibt Diskussionsrunden, Konzerte, Nachtgottesdienste, Lesungen. Bis zu tausend Jugendliche und junge Erwachsene nehmen daran teil.
Solidarität mit Wolf Biermann
In Jena übernimmt die „Junge Gemeinde Stadtmitte“ um Diakon Thomas Auerbach bereits 1970 Arbeitsformen der Offenen Arbeit. So wird die Junge Gemeinde zu einem Versammlungsort unangepasster, gegen Bevormundung aufbegehrender Jugendlicher. Wer mit der Staatsmacht in Konflikt gerät, findet hier Unterstützung und Beratung.
Seit 1975 gibt es Verbindungen zur alternativen Szene um die Schriftsteller Lutz Rathenow, Jürgen Fuchs und andere. Es finden Lesungen statt und kritische Liedermacher treten auf. Die Aktiven aus dem kirchlichen Milieu sind von der lateinamerikanischen Befreiungstheologie und der Theologie der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung inspiriert.
Nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann im November 1976 organisieren die Jenaerinnen und Jenaer eine Solidaritätsaktion. Etwa fünfzig Personen werden festgenommen. Walter Schilling ist es zu verdanken, dass die Arbeit weitergeht.
Bluesmessen in Ostberlin
Zu einem Treffpunkt unangepasster Jugendlicher werden die Bluesmessen mit Rainer Eppelmann in der Samariterkirche. Am 1. Juni 1979 findet die erste Messe mit einigen hundert Beteiligten statt. Ende des Jahres sind es etwa tausend Jugendliche und im Jahr darauf mehrere Tausend, die zu den Bluesmessen aus allen Teilen des Landes anreisen.
Die Vorbereitung liegt in den Händen einer Gruppe, in der Rudi Pahnke, Stadtjugendpfarrer Martin-Michael Passauer, Ralf Hirsch und engagierte Jugendliche mitarbeiten.
Thematisiert werden die Militarisierung und Disziplinierung in der Gesellschaft, die Angst, die eigene Meinung zu sagen, die Diskriminierung bei der Berufswahl und Umweltprobleme. Staatliche Stellen fordern von der Kirchenleitung die Einstellung der Messen. Konsistorialpräsident Manfred Stolpe signalisiert Entgegenkommen.
Dank des Einsatzes von Eppelmann und der Helfergruppe bleiben die Messen jedoch ein Treffpunkt von Jugendlichen, die sich dem Anpassungsdruck widersetzen.
Im Sommer 1979 bietet der Musiker Günter Holwas an, in der Samariterkirche ein Blueskonzert zu veranstalten. Rainer Eppelmann (3. von links) gibt dem Konzert einen gottesdienstlichen Rahmen.
Quelle: Bundesstiftung Aufarbeitung/Harald Hauswald – Ostkreuz, Bild 891001hh84
Jugendliche aus der Punk-Szene auf dem Kirchengelände.
Quelle: Bundesstiftung Aufarbeitung/Harald Hauswald – Ostkreuz, Bild 891001hh155
Gewaltlos Frieden üben
In der Dresdner Weinbergsgemeinde übernimmt Pfarrer Frieder Burkhardt 1970 die Jugendarbeit. Hier treffen sich junge Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Milieus. Sie eint ihr Aufbegehren gegen die geistige Enge der DDR-Gesellschaft. Frieder Burkhardt gibt diesem Lebensgefühl eine Stimme.
Inspiriert durch die Theologie Dietrich Bonhoeffers vermag er es, Inhalte der christlichen Botschaft in die Lebenswirklichkeit des DDR-Alltags zu übersetzen. Die politische Brisanz biblischer Texte kommt in den ökumenischen Jugendgottesdiensten zur Geltung. Im „Credo“ zum Gottesdienst „Passion ‘72“ heißt es:
„Ich glaube, dass die Schlagkräftigen, die Kriegsspielzeughersteller, die Weltmachtstreber und deren Gönner gegen mich sein müssen, wenn ich mit meinen Freunden gewaltlos Frieden übe. Es sei denn, meine Gewaltlosigkeit wird ihnen heilig.“
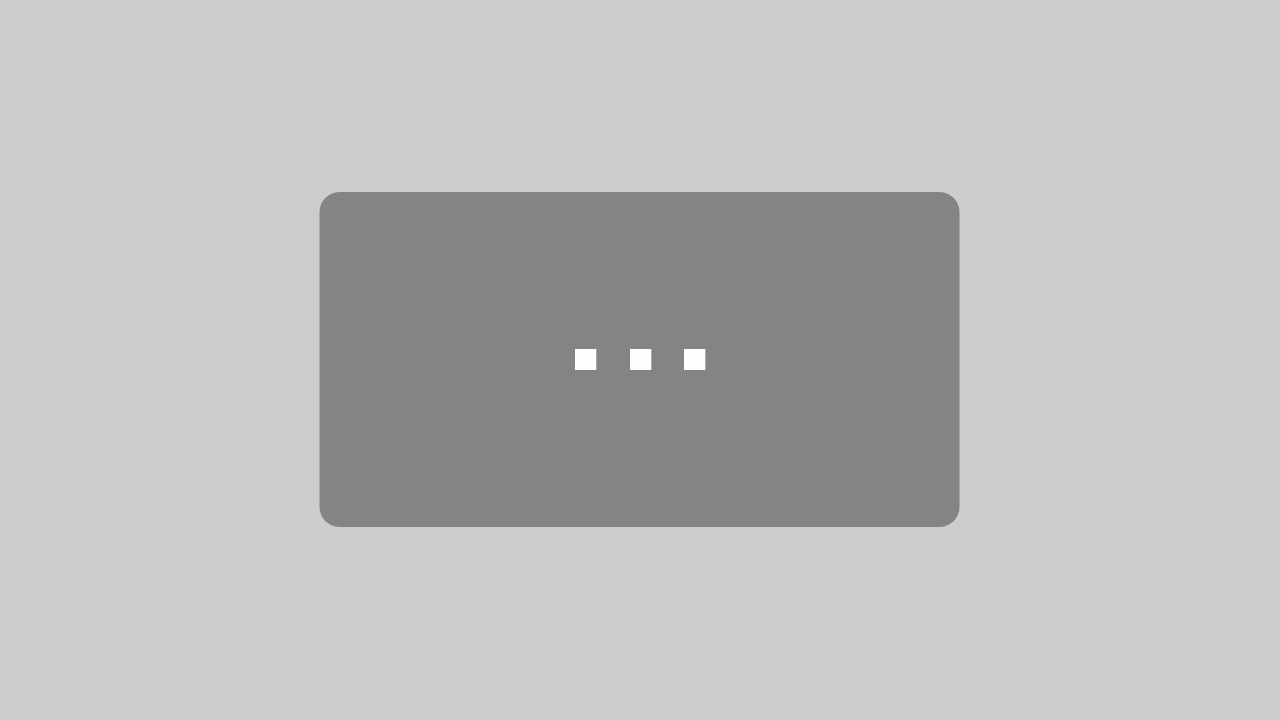
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Joachim Krause, Naturwissenschaftler, über Kirche, wie er sie nie erwartet hätte
Demokratie in der Kirche
Die evangelischen Kirchen sind demokratisch konstituiert. Vom Gemeindekirchenrat beziehungsweise Kirchenvorstand bis zur Landes- und Bundessynode werden die parlamentarischen Gremien gewählt.
In den Parlamenten der acht Landeskirchen werden gesamtkirchliche Belange verhandelt und entschieden, und es finden Wahlen zur Besetzung der Leitungsämter statt. Die Landessynodalen wählen aus ihren Reihen die Vertreterinnen und Vertreter der Landeskirche in der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. Besonders die Landessynoden und die Bundessynode sind zu DDR-Zeiten Refugien parlamentarischer Arbeit in einem autoritären System. Hier wird auch zu brisanten gesellschaftspolitischen Problemen Stellung bezogen.
Zahlreiche Frauen und Männer lernen in den Synoden das parlamentarische Handwerk. Sie bestimmen im Herbst 1989 das politische Geschehen aktiv mit – zunächst in den neuen politischen Gruppierungen und an den Runden Tischen, dann in den frei gewählten Gremien auf regionaler, Landes- und Bundesebene.
Mitglieder des Kirchenvorstandes Frauenstein beim Arbeitseinsatz an der Friedhofskapelle. In den Kirchenvorständen beziehungsweise Gemeindekirchenräten entscheiden von den Gemeindegliedern gewählte Frauen und Männer über Gemeindekonzepte, Personalfragen und den Einsatz der finanziellen Mittel.
Quelle: Bernd Albani
Am 7. Mai 1989 finden Kommunalwahlen statt. Wie alle Wahlen seit der Gründung der DDR entsprechen sie in keiner Weise demokratischen Standards. Im April 1989 beschließt die Landessynode Sachsen, zu den Wahlen Stellung zu nehmen – ein Affront gegen die SED-Führung.
Quelle: Archiv Bernd Albani
Bekennen in der Friedensfrage
Angesichts der Zuspitzung des atomaren Wettrüstens formuliert die Bundessynode 1982 in Halle die „Absage an Geist, Logik und Praxis der Abschreckung“. Auch in den folgenden Jahren steht das Thema Friedensverantwortung immer wieder auf der Tagesordnung. 1987 heißt es im Beschluss der Bundessynode zum „Bekennen in der Friedensfrage“:
„Die Praxis der Abschreckung (…) führt zu einer Militarisierung des Lebens und Denkens von Kindergarten und Schule bis hin zur Weltwirtschaft und Wissenschaft. (…) Weil wir dem Geist Gottes folgen, widersprechen wir der Praxis der Abschreckung. (…)
Jeder Christ, der vor die Frage des Wehrdienstes gestellt ist, muss prüfen, ob seine Entscheidung mit dem Evangelium des Friedens zu vereinbaren ist. (…)
Die Kirche sieht in der Entscheidung von Christen, den Waffendienst oder den Wehrdienst überhaupt zu verweigern, einen Ausdruck des Glaubensgehorsams, der auf den Weg des Friedens führt.“
Umstritten: Das politische Mandat der Kirche
Die Frage, wie weit das politische Mandat geht, wird in den evangelischen Landeskirchen kontrovers diskutiert. Jüngere Gemeindeglieder sind von der Offenheit geprägt, die sie in der kirchlichen Jugendarbeit und in Studentengemeinden erfahren und eingeübt haben. Für sie ist das Aufbegehren gegen die vom SED-Regime geforderten Unterwürfigkeitsrituale Ausdruck ihrer Glaubensüberzeugung. Ihr kritischer Blick auf die gesellschaftlichen Probleme des Landes motiviert sie zum Engagement in Friedensgruppen, in der Ökologie-Bewegung und in Bürgerrechtsinitiativen.
Autoritäten in den kirchlichen Leitungsebenen agieren dagegen oft zurückhaltend bis ablehnend. Sie sehen Freiräume kirchlicher Arbeit durch provokatives Auftreten gegenüber dem Staat gefährdet. Für pietistisch oder evangelikal geprägte Gruppierungen gehört es ohnehin nicht zum Auftrag von Kirche, zu politischen Fragen Stellung zu nehmen. SED-nahe Kirchenleute sehen in staatskritischen Aktivitäten gar den „Klassenfeind“ am Werke. Aber auch eher bürgerlich Orientierte halten Distanz zu den Gruppen, weil diese überwiegend an der Vision eines „verbesserten“, eines demokratischen Sozialismus festhalten.
Die Spannung zwischen Solidarität und Konfrontation im Verhältnis von Gruppen und Leitungsebene wirkt 1989/90 in der Phase des Übergangs vom autoritären System zu demokratischen Strukturen jedoch durchaus produktiv.
Quelle: Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V., Foto 061-014-001/Christoph Motzer